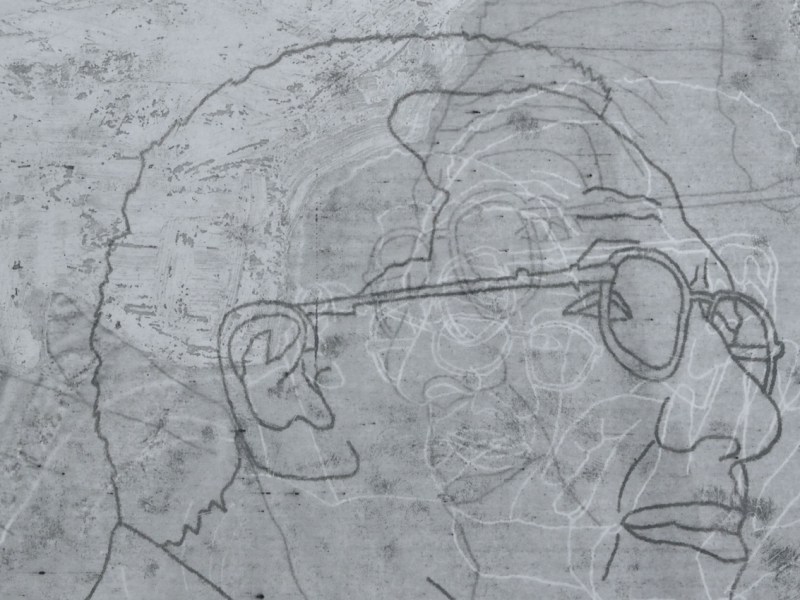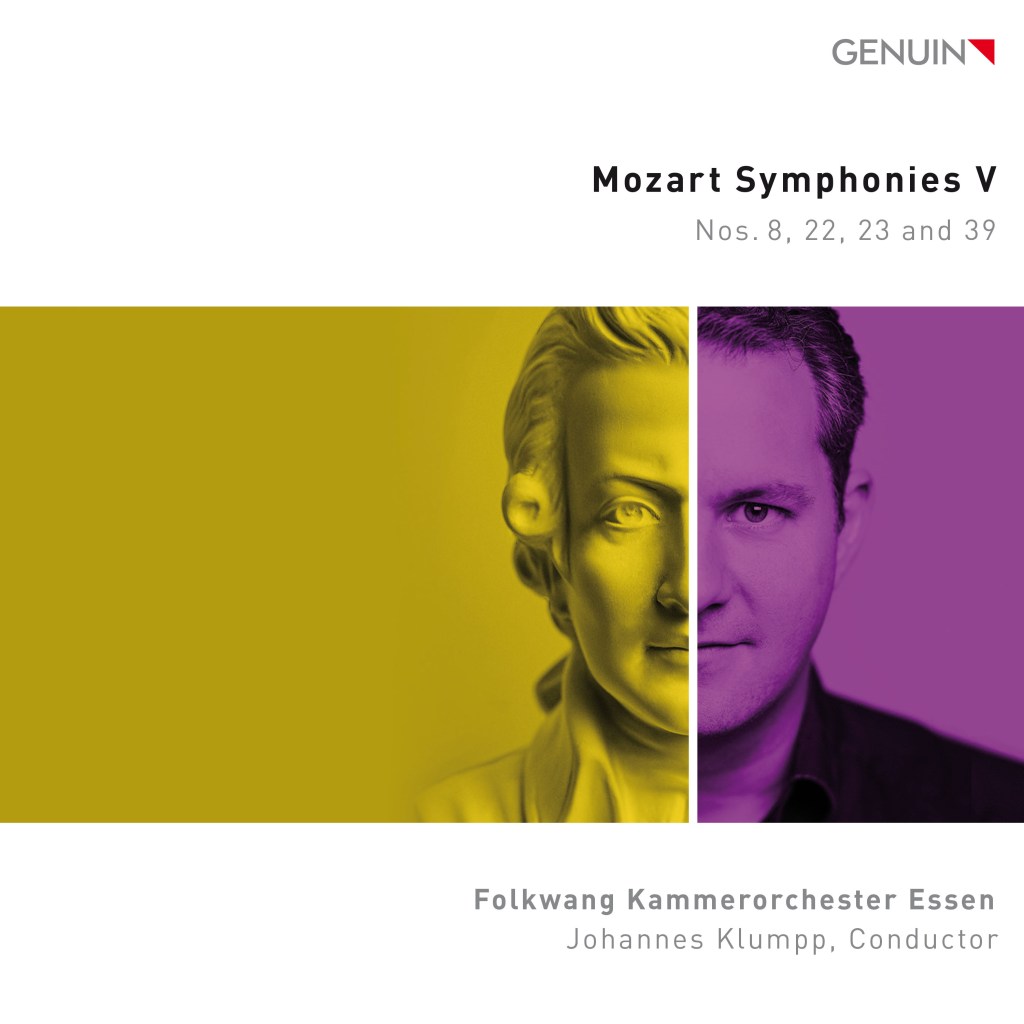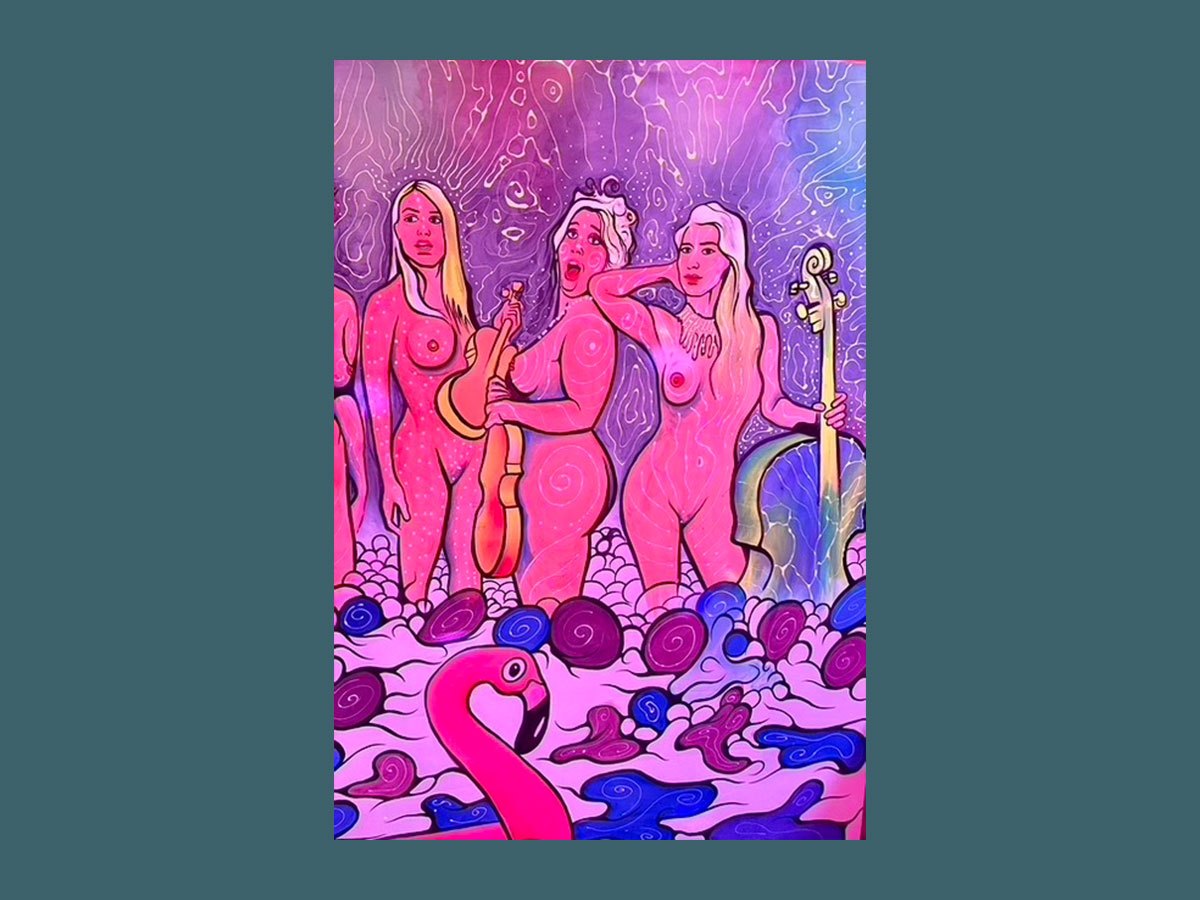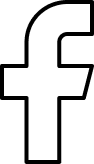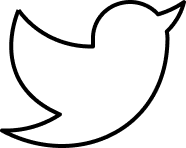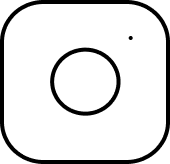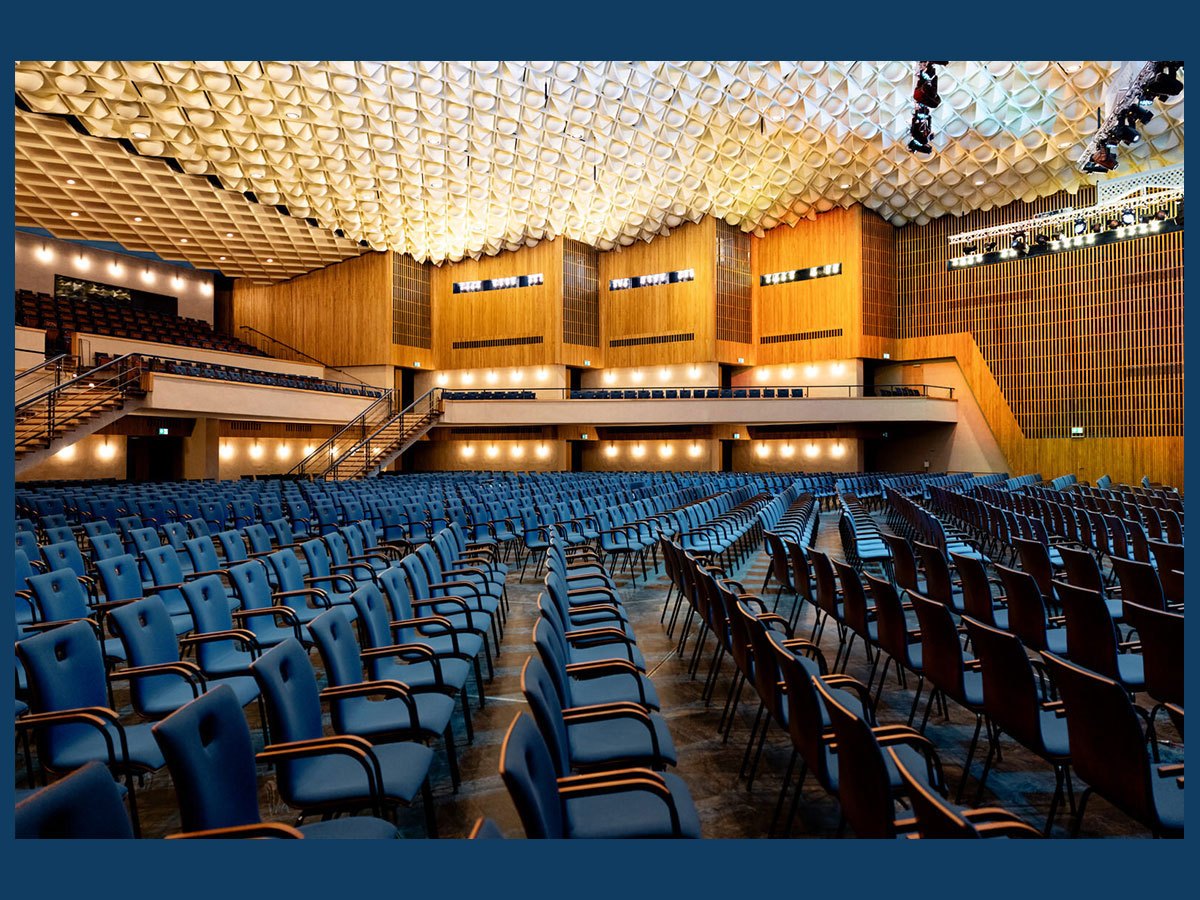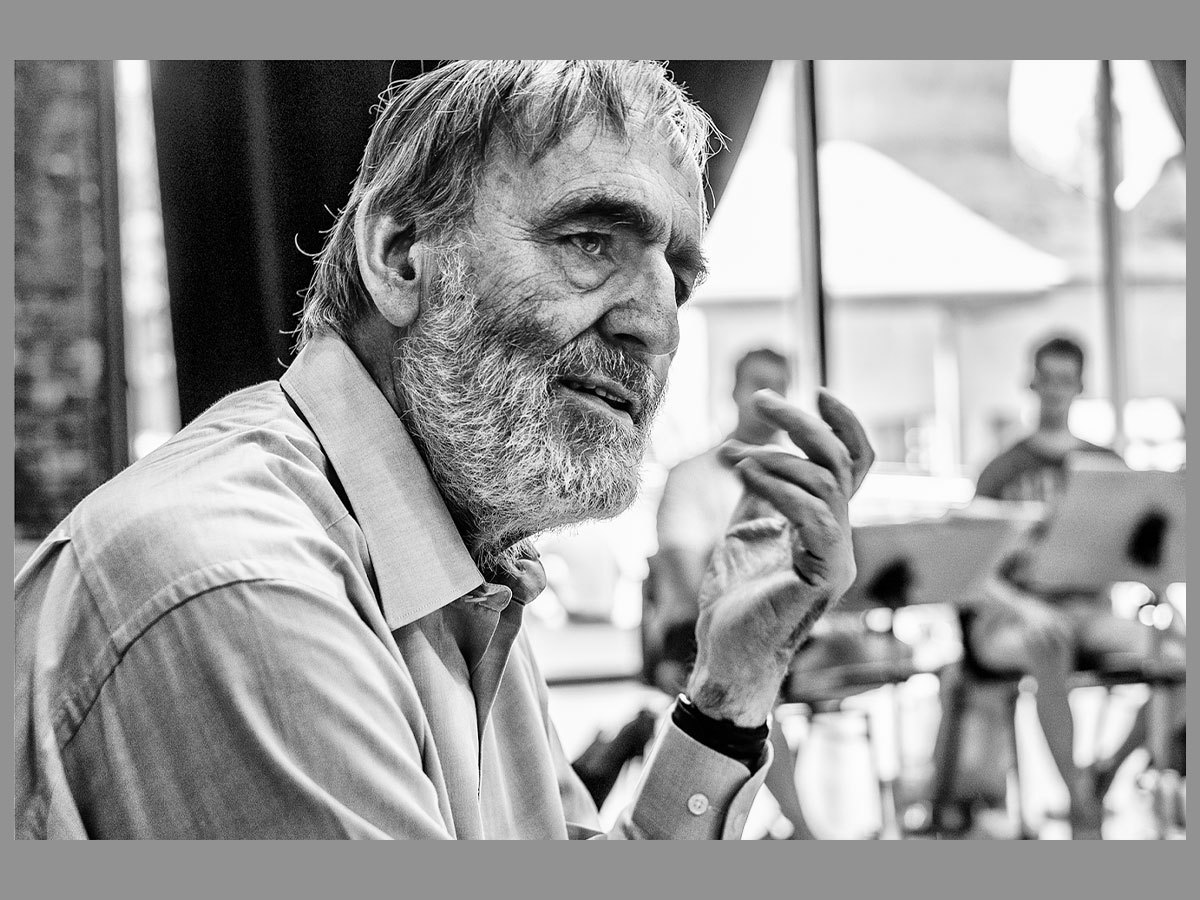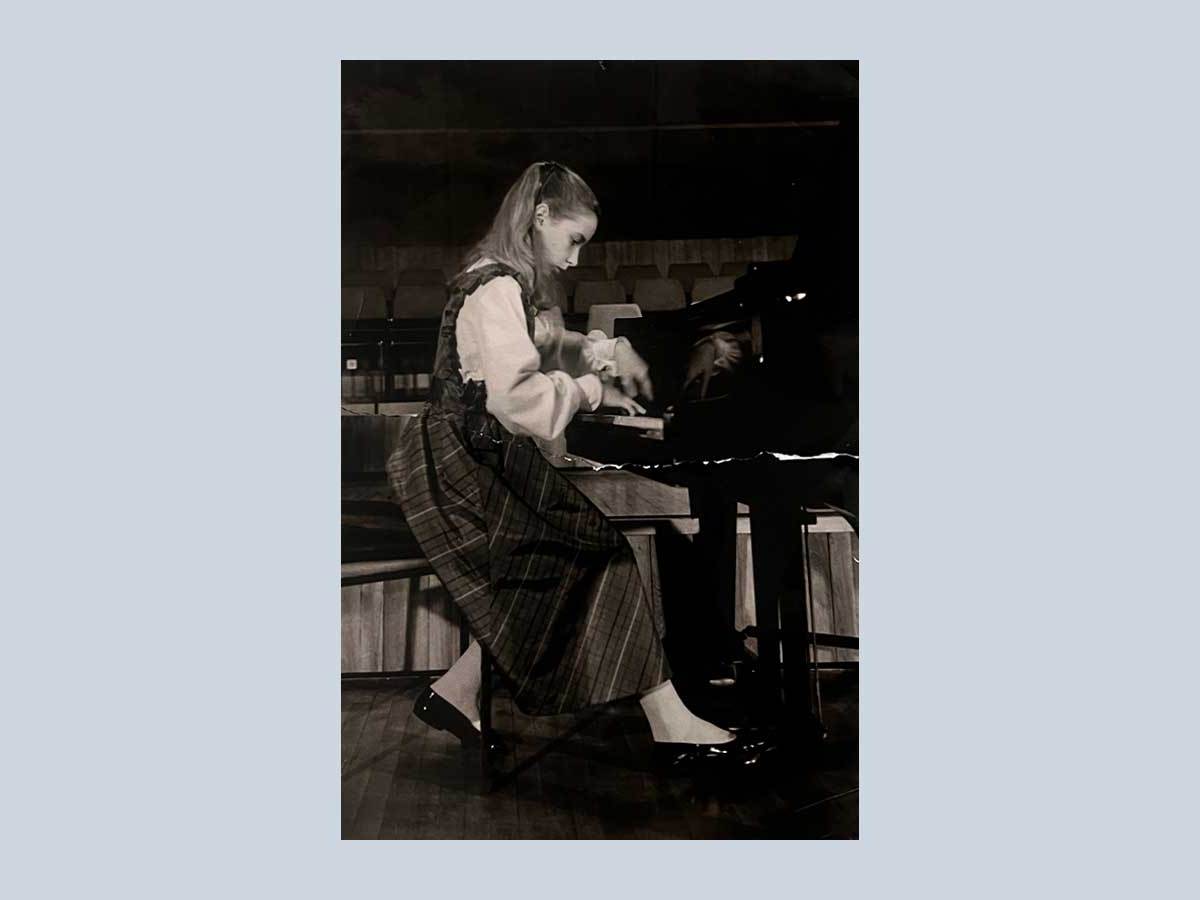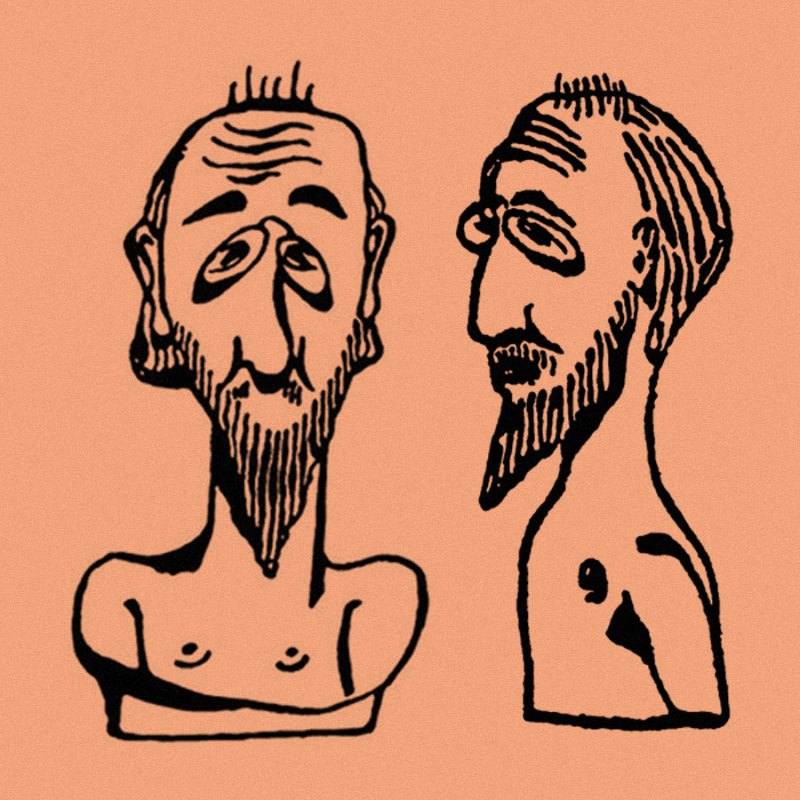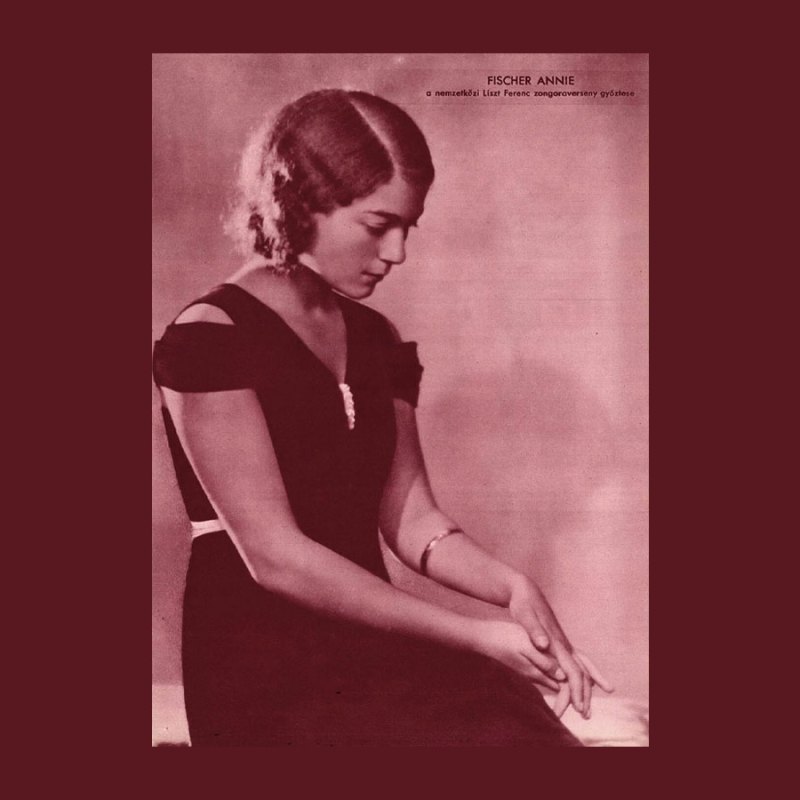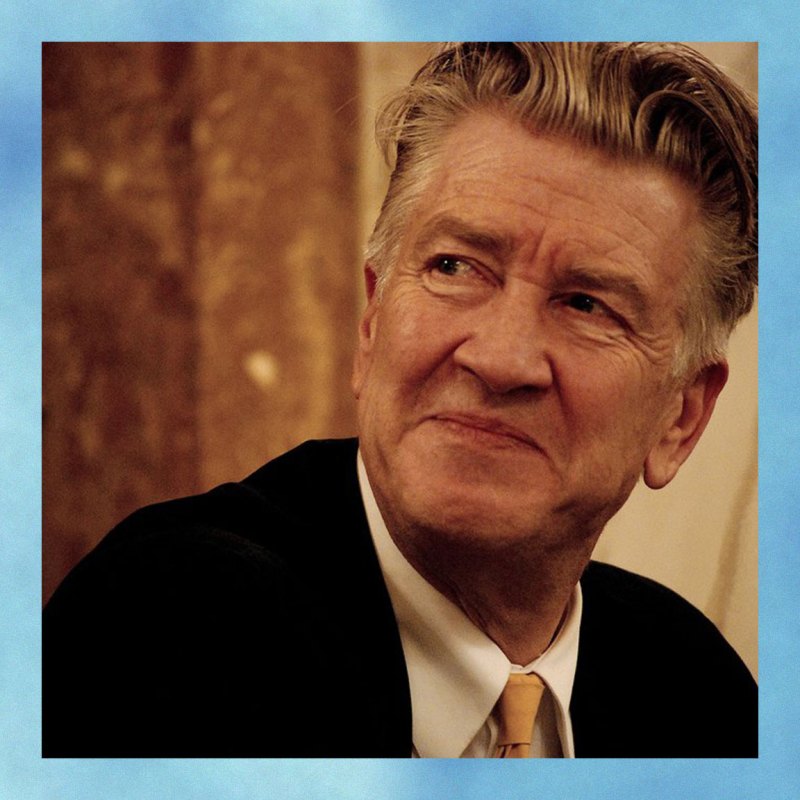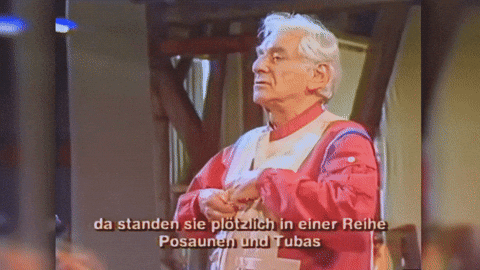Virtuosität der Poesie
Vielleicht habe ich nicht genug getan
»Seit er denken konnte, wusste er, wer er war.«
Més que un Konzerthaus
Trugschluss
Ins Ungewisse hinab, ins Ungewisse hinauf
Dirigent:innen Klavier Komponist:innen Kulturpolitik Musik & Politik Musik als Beruf Neue Musik Oper Orchester
Kolumnen
Albrecht Selge
Hundert 11
Triangle of Happiness
Angst stecken Seele an
Im lila Rössl der Psychoapokalypse
Holger Noltze
The Society of Music
Gemein frei!
Das Große Kasperle
Orff im Museum
Volker Hagedorn
Rausch & Räson
Piaf und die Gänsehaut
Treffen am Südpol
Die letzte Diva
György Kurtág 100
»Er ringt um jeden Ton, das hat auch einen ethischen Aspekt: Er will für diese Töne geradestehen.«
Eine Lektion in musikalischer Wahrheitsfindung
Entspielend
Fin de Partie
ANZEIGE
Audio der Woche

Lars Conrad und Daniel Prinz mit Robert Schumanns Belsatzar op. 57
»Wann ist ein Mann ein Mann?«, fragt nicht nur Herbert Grönemeyer, sondern auch das Liedduo Conrad-Prinz auf seinem GENUIN-Debütalbum. Es geht um die männliche Identität im Spiegel von Musik und Lyrik des deutschen Kunstlieds von Franz Schubert bis Hanns Eisler. Das Künstlerduo versteht das Album als Impuls zur Identitätssuche, in persönlicher Auseinandersetzung mit der Krise der Männlichkeit oder des Männlichkeits-Bildes. Klangschön und differenziert interpretieren Lars Conrad (Bariton) und Daniel Prinz (Klavier) Werke, die allesamt Spiegel ihrer Zeit und unserer vielgesichtigen Gegenwart sind.