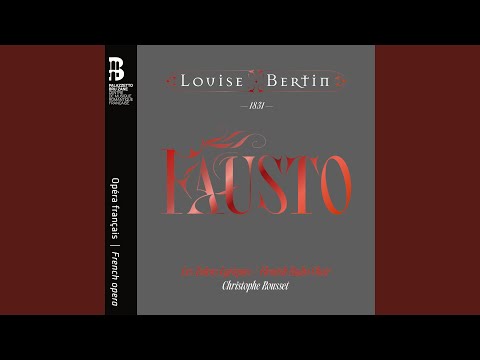Schon vom ersten Ton der Ouvertüre an zieht diese Oper laufend den Hut und grüßt liebe alte Bekannte. Zuerst: Mozarts Don Giovanni. Der berühmte Auftrittsakkord des Komturs ist von d-Moll nach g-Moll gerutscht, er wird auch anders aufgelöst. Folgt der Einsatz der Kontrabässe, ein bisschen zu früh, rollen die auch nicht düster drohend in Tonleitern auf und nieder, sondern absolvieren vielmehr eine Dreiklangs-Kadenz. Es geht weiter mit einer Singspiel-Idylle à la Freischütz: mit Hörnerchoral und Oboensehnsucht; mit leitmotivischem Blechgetöse, sequenzierten Fanfaren; Paukenwirbeln. Man kann nicht behaupten, dass diese Musik unselbstständig wäre. Sie leiht sich Ideen von Freunden aus, verarbeitet sie weiter. Wer das schrieb, hatte offenbar viele Freunde.
Die dramatische Steigerung der Ouvertüre erinnert an die Wolfsschlucht. Die erste Arie, die gesungen wird, beginnt mit einer Melodie aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach. Aber auch Referenzen an Rossini, eine Prise Bellini und Berlioz sind eingemeindet worden in diese erste Faust-Oper der Musikgeschichte, komponiert frei nach Goethe. Sie wurde uraufgeführt am 7. März 1831 – da lebte der alte Goethe noch – am »Théâtre-Italien« in Paris. Selbstverständlich als Semiseria und, wie es die Tradition verlangte, auf italienisch.
Nicht selbstverständlich: Komponist war eine stadtbekannte Pariserin – eine Frau. Sie war beliebt, sie war erfolgreich. Das Libretto zu dem Stück schrieb sie sich selbst. Das Publikum habe viel applaudiert, berichtete am 14. März La Tribune des départements, und weiter heißt es: »Das ausgerechnet in einem Theater, in dem Mozart gespielt wird. Das sagt alles!«
Louise-Angélique Bertin, geboren 1805, malte, dichtete und komponierte. Teils kleine Klaviersachen, teils Kirchenmusiken. Und teils große Oper. Sie war eine Tochter aus gutem Hause. Von Kindheit an gelähmt, fiel ihr gesellschaftlich eine Sonderrolle zu. Viele Chancen und Möglichkeiten blieben ihr verschlossen. Andererseits war ihr Elternhaus auch ein Schutzraum, in deren Salon verkehrten berühmte Künstler. Die privaten Musiklehrer Bertins hießen François-Joseph Fétis und Anton Reicha – bessere ließen sich seinerzeit nicht auftreiben in Paris. Ihre erste Oper Guy Mannering, nach Walter Scott, brachte sie heraus, als sie zwanzig war. Drei weitere folgten, die alle in Paris uraufgeführt und nicht nur vom Publikum akklamiert sondern auch von Komponistenkollegen wie Meyerbeer oder Berlioz hoch geschätzt wurden. Warum Bertin dann 1836 nach ihrer vierten Oper La Esmeralda, zu der Franz Liszt den Klavierauszug schrieb und die dem Vernehmen nach ihre beste sein soll, plötzlich aufhörte, zu komponieren; warum sie es zwar einerseits nach ihrem Tod in die Musiklexika schaffte, aber andererseits ihre Bühnenwerke, zu denen ihr immerhin Eugène Scribe oder Victor Hugo die Libretti schrieben, nicht den Weg ins Repertoire fanden, das wäre Stoff für einen Roman, der erst noch geschrieben werden müsste.
So stellt sich das heute dar. Alle Spekulationen darüber, ob Unbekanntes zu Recht vergessen und das Vergessene womöglich nur minderer Güte sei, kann man sich ab jetzt sparen. Man kann stattdessen hören, sehen, vergleichen, urteilen.
Zumindest Bertins Fausto-Oper ist wieder aufgetaucht, nach fast zweihundert Jahren Dornröschenschlaf. Sie wurde mit besten Kräften ans Licht befördert. Erst durch die musikwissenschaftliche Kärrnerarbeit der Stiftung Palazzetto Bru Zane, die das Notenmaterial aus den Archiven holte und für die Praxis aufbereitete. Dann durch Christophe Rousset und sein Ensemble Les Talens Lyriques, die eine konzertante Aufführung bewerkstelligten, im Sommer 2023 in Paris. Sie präsentierten die Urfassung des Fausto von 1830 mit historischen Instrumenten, das Label der Stiftung produzierte mit ihnen anschließend unter Studiobedingungen eine Aufnahme. Und nun hat das Aalto-Theater in Essen die erste szenische Wiederaufführung des Fausto gestemmt, und zwar in der von Bertin überarbeiteten Zweitfassung von 1831 und mit modernen Instrumenten. Einziges Zugeständnis: ein Hammerflügel, für die Rezitative.
Die Essener Philharmoniker unter der Leitung von Andreas Spering ließen es also ordentlich krachen. Auch der Opernchor des Aalto-Theaters, einstudiert von Klaas-Jan de Groot, agierte souverän. Die von Bertin orgiastisch entfesselte Bläserfarbenpracht kam herrlich zur Geltung. Ebenso die Dynamik der Chorpartien, die den Rahmen einer Semiseria-Oper offenkundig bereits sprengen. Wie überhaupt die alte Nummeroper, mit ihren sauber getrennten Arien und Rezitativen, in diesem Stück aufgeht in quasi durchkomponierten Ensembleszenen. Auch in Bezug auf etliche überraschende harmonische Fortschreitungen ist dieses Stück eben nicht nur nicht epigonal, sondern geradezu avantgardistisch.
Die Titelpartie des Faust – anspruchsvoll, mit großem Ambitus – hatte Bertin in der Erstfassung von 1830 noch besetzt mit einem Mezzosopran, wodurch die Liebes- aber auch die finalen Verzweiflungsduette, terzweise verschlungen von Sopran und Mezzosopran, ungleich wirkungsvoller waren. In der Rousset-Aufnahme wird der Faust gesungen von Karine Deshayes. In Essen dagegen singt, wie bei der Uraufführung der Zweitfassung 1831, ein Tenor den Faust: Mirko Roschkowski, heldenhaft kraft- und glanzvoll. Er wird übertroffen von seinem Widersacher Mephisto, für den Almas Svilpa auch noch Charakterfarbe und Witz mitbringt. Die bösen Baritone haben es halt immer etwas leichter, über die Rampe zu kommen. Wobei in der Geschichte, wie Bertin sie erzählt, Gutes und Böses sich nicht volksbuchhaft grundsätzlich aufteilt in Oben und Unten, Himmel und Hölle, so, wie im Goetheschen Schauspiel. Auch die von Goethe implantierten Lieder hat sie nicht vertont.

Bertin hat ihre eigenen Lieder und Melodien erfunden. Auch geht es in dieser Faust-Oper banaler, handgreiflicher zu. Es ist kein Teufelspakt nötig, als Lizenz für den Mann, sich schlecht zu benehmen. Faust ist sich selbst Teufel genug. Trifft gleich anfangs aufs Gretchen, das mag ihn nicht, weil er so alt und hässlich ist. Also malt er ein Pentagramm auf den Bühnenboden und ruft Satanas an: Der möge ihn verjüngen. Nachdem er dann als Schönling in vier kurzweiligen, an Quartetten, Duetten, Chorszenen und Ensembles überreichen Akten hinreichend Unheil angerichtet, das Mädchen geschwängert und deren Bruder ermordet hat, fährt er pünktlich zur Hölle – mit einem ernüchternd schlichten Beckenschlag und ganz ohne philosophisches Unterfutter.
Netta Or sang die Partie der Margarita, kurzfristig eingesprungen für die erkrankte Jessica Muirhead, aus den Noten, seitlich vom Bühnenrand. Das war mehr als nur mutig, es gelang bewundernswürdig. Szenisch auf der Bühne agierte die Regisseurin Tatjana Gürbaca persönlich: als eine charmant tänzerisch mobile, mimisch etwas übertrieben neckische Margarita. Bereits im Vorfeld hatte Gürbaca erklärt, es sei nötig, diese altbekannte Geschichte »so nahe wie möglich an unsere eigene Zeit« heranzuholen. »Nahe«, das bedeutet in diesem Falle einmal wieder: In die Mitte des vorigen Jahrhunderts, die Petticoat-Zeit. Auch das Bühnenbild haben wir schon öfters so oder ähnlich gesehen. Seit etlichen Jahrzehnten nämlich weisen die Opernregieteams, inzwischen schon in der dritten Generation, die Repertoirestücke unter Verdacht auf Demenz gern ins Krankenhaus ein. Oder ins Seniorenheim. Oder gleich in die Pathologie.

Wir werden also Zeuge, wie Chefarzt Dr. Faust in opernüblich klinischem Weiß und Neonlicht eine männliche Leiche seziert, von der wir alsbald ahnen, dass sie demnächst als der Leibhaftige von der Bahre springen wird. So kommt es. Wie langweilig. Mephisto verschlingt umgehend, mit einem Haps, das Organ – Milz oder Leber – das ihm zuvor entnommen wurde. Auch das ist nur bedingt witzig. Ebenso, dass sich der Krankenschwestern-Chor zum Hexensabbat der adretten Häubchen entledigt, Haare öffnet, Kittel aufknöpft und sich zu lasiv-geilen Menschenknäueln verknotet. Und so geht das weiter, bis zum Schluss. In den Chorszenen, im zweiten Teil des Abends, wenn Lernschwester Margarita sich konfrontiert sieht mit der hasserfüllten Ausgrenzung der Kolleginnen, werden immerhin die Personenführungsqualitäten Gürbacas sichtbar. Aber die Sache geht nicht auf. Und ein bisschen schade ist es schon, dass ein unbekanntes Stück sofort in aller Freundschaft übermalt wird mit heutigem Alltagskram. ¶