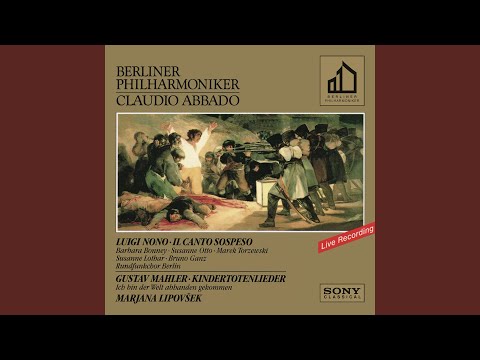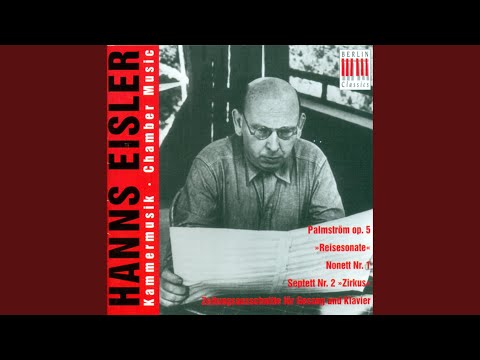John McWhorter, Linguist der Columbia University und Kolumnist der New York Times, brachte am 26. April die 300-Millionen-Köpfe-Hydra der Hysterie (auch bekannt unter dem Namen Twitter) zum Zischen mit dem Post seines Kommentars Classical Music Doesn’t Have to be Ugly to be Good. McWhorter meinte unter Berufung auf zwei kürzlich erschienene Bücher unter anderem, dass serielle Musik oder Zwölftonmusik sowohl Schönheit als auch nachvollziehbare Abläufe und Proportionen komplett vermissen ließe. Mit Blick auf ein Werk Luciano Berios kam er zu dem Schluss, dass er sich »gezwungen« fühle, »zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass klassische Musik ab einem bestimmten Punkt nur noch schlimm klingen kann.«
Verfolgt man heutige, vor allem amerikanische Debatten über zeitgenössische klassische Musik, könnte man meinen, dass die prominentesten Serialist:innen – insbesondere die Komponisten der Nachkriegszeit Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen – Vorstellungskraft und Ideenreichtum von Generationen von Komponist:innen im Keim erstickt haben. (John Adams, der in den 1970er Jahren Komposition studierte und heute der mit Abstand meistgespielte klassische Komponist Nordamerikas ist, sieht sich selbst immer noch als mutigen Rebellen gegen Exzesse der seriellen Überheblichkeit europäischer Komponist:innen.) Tatsächlich dominierten die Serialist:innen in den 1950er und frühen 1960er Jahren die Neue Musik, an den Universitäten machten sie es sich noch etwas länger gemütlich. Ich glaube allerdings, dass zumindest im Falle von Stockhausen und Boulez ihr Charisma und ihr tiefes psychosexuelles Bedürfnis nach Verehrung und Macht daran einen genauso großen Anteil hatten wie ihre Kompositionstechnik. Jedenfalls schrieb Stockhausen 1968 seine hübsche Stimmung für sechs Stimmen in einfachen Obertonverhältnissen und Boulez dirigierte den Parsifal in Bayreuth. Selbst wenn man die Prämisse akzeptieren würde, dass alle serielle Musik schlimm klingt, so war ihre Herrschaft weder so lang noch so brutal, wie man aufgrund des Gegenwindes, den diese Kompositionstechnik noch 2022 erfährt, annehmen könnte.
Außerdem stimmt die Behauptung, dass es in serieller Musik »weder Schönheit noch nachvollziehbare Abläufe noch Proportionen« gäbe, einfach nicht. (Und es ist höchst fragwürdig, ob das wirklich die einzig relevanten Kriterien für gute Musik sind, aber das ist ein ganz anderes Thema). Natürlich gibt es viele schreckliche serielle Kompositionen – genau wie es auch viel Überflüssiges im Galanten Stil gibt. Aber es gibt eben auch Stücke, die seriell und wundervoll sind. Acht von ihnen stellt diese Playlist vor.
Arnold Schönberg: Violinkonzert Op. 36
Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, besuchte ich eines der ersten Konzerte von James Levine mit dem Boston Symphony Orchestra. (Ja, ich kenne mittlerweile natürlich Levines Vergehen.) Auf dem Programm standen die Violinkonzerte von Beethoven und Schönberg, gespielt von Christian Tetzlaff. Alles, was ich damals über Schönberg wusste, war, dass Erwachsene ihn offenbar nicht mochten, was ihn mir sofort sympathisch machte. Dann kam dieses Stück und haute mich um mit seiner Leidenschaft und Virtuosität, seinem Überschwang und seinem offensichtlichen Serialismus. Ich glaube, einer der Gründe für den miesen Ruf des Serialismus ist, dass die Werke einzelnen Musiker:innen selten die Chance geben wirklich zu glänzen. Es fehlt dem Serialismus also an charismatischem Personal auf der Bühne. Schönbergs Violinkonzert ist absolut virtuos; ich würde es jederzeit dem romantischen (und viel einfacheren) Bruch-Violinkonzert vorziehen. Schönbergs Werk mag zwar keine Melodie haben, die man während der Konzertpause nachsummt, aber er ist unglaublich einfallsreich, was Gesten und Texturen angeht.
Anton Webern, Sechs Bagatellen Op. 9, V. Äußerst langsam
Nur wenige Klänge beschwören so schnell eine romantisch-mysteriöse Stimmung herauf wie die gedämpften Streicher zu Beginn des fünften Satz von Weberns Sechs Bagatellen für Streichquartett (die insgesamt kaum fünf Minuten dauern). Dieser großartige, introspektive fünfte Satz ist voller Referenzen an romantische Exzesse à la Wagner und sogar Strauss, nur eben in einer extrem reduzierten, bescheidenen Variante. Eine melodische große Sekunde eröffnet den Satz und wächst, als wolle sie anheben zu einer endlosen Melodie, sie hält aber nicht länger als zwei Töne durch. Einige Takte später gesellt sich das Cello im sehr hohen Register zur Bratsche, beide spielen eine dissonante kleine Sekunde, die sich für einen kurzen Moment in eine kleine Terz auflöst. In diesem Spiel von Spannung und Entspannung ist letztere kaum wirklich auszumachen – aber sie ist da. Der Satz dauert nur etwas mehr als eine Minute, klingt aber noch lange nach. Vielleicht ist das eine der Säulen der Schönheit in der Musik: dass die Zeit, die sie wirklich dauert, in überhaupt keinem Verhältnis steht zu der Zeit, die man damit verbringt, ihr nachzusinnen.
Alban Berg, Verwandlungsmusik aus Lulu, 1. Akt
Während Webern in seinen Bagatellen sozusagen die leisesten Anspielungen liefert, die man auf das hochromantische Repertoire überhaupt machen kann, nutzt Berg (im Sinne seines Lehrers Arnold Schönberg) meisterhaft die Sprache des post-Wagner-Orchesterklangs, um die radikale Lulu ins bürgerliche Opernhaus zu schmuggeln. Die Verwandlungsmusik aus dem ersten Akt vollbringt in ihren drei Minuten Bemerkenswertes: Sie reißt einen in ihren unwiderstehlichen Sog, und dennoch spüre ich nichts von dem Unbehagen, der mich zumindest beim Hören der Spätwerke von Richard Strauss überkommt und das ich mit Faschismus assoziiere. Die Verwandlungsmusik fesselt, ohne sich anzubiedern, sie umschlingt das Publikum von allen Seiten, aber sie zieht ihm nicht mit dem Knüppel eins über. Diese Gegenmelodien in den Flöten sind das reinste Vergnügen.
Pierre Boulez, Le marteau sans maître, VI. Bourreaux de solitude
Gérard Grisey (ein leidenschaftlicher Kritiker und gleichzeitig heimlicher Bewunderer des Serialismus und insbesondere Pierre Boulez’) meinte einmal, Zwölftonkomponist:innen machten häufig den Fehler, zu viel Klang und Kontraste auf zu wenig Raum unterbringen zu wollen, was das Gehirn nur überfordere und die Dramaturgie der Stücke auf eine einzige graue Pampe eindampfe. Das gilt sicherlich für viele Stücke Boulez’, einschließlich der für Ausführende wie Publikum herausfordernden monochromen Klaviersonaten. Andere Boulez-Werke jedoch – vor allem die mit größeren und vielfältigen Besetzungen – klingen wie exzentrische Verwandte der Werke Debussys, in denen schwer fassbare Formen durch den verschwenderischen Einsatz von Klangfarben ausgeglichen werden. Deren Mischung und die zurückhaltende Eleganz des Gesangs im sechsten Satz von Le marteau sans maître für Altstimme und Ensemble machen dieses Werk zu einem der schönsten, die Boulez je geschrieben hat. Wenn es endet, hört man nicht einfach auf zuzuhören, man kriecht aus ihm hervor wie aus einem wundersamen und etwas gruseligen Dschungel, verschwitzt und mit den Haaren voll von merkwürdig wimmelnden Kreaturen.
Luigi Nono, Il canto sospeto, II.
Der Beginn von Nonos Kantate Il canto sospeso für Alt, Tenor, gemischten Chor und Orchester vollbringt eigentlich Unmögliches. Der erste Satz des Werks besteht ausschließlich aus den letzten Briefen von antifaschistischen Widerstandskämpfer:innen, die während des Zweiten Weltkriegs zum Tode verurteilten wurden. Diese werden ohne jede Begleitung vorgetragen. Welche Musik, will man frei nach Adorno fragen, könnte danach folgen? Die Antwort könnte diese Aufnahme bei 1:25 liefern: Streicher, so zart und schön, dass sie kaum vorhanden zu sein scheinen, wie ein Regenbogen, den man nur sieht, wenn man den Kopf genau im richtigen Winkel hält. Dieser Satz hat auch Passagen, die nicht im eigentlich Sinne schön sind. Aber am Ende des Satzes kehrt die engelsgleiche Passage wieder. Was bleibt, ist der Hauch von Zärtlichkeit inmitten all der Trostlosigkeit.
Hanns Eisler, Reisesonate
Bis hierhin bestand diese Playlist vor allem aus eher langsamer Musik, denn in ihr zeigt sich die Zwölftontechnik von ihrer besonders sinnlichen Seite. Schnelle Sätze scheinen oft eher kantig, durchbrochen, hart (so schreiben es zumindest viele Kolleg:innen gern in ihren Kritiken). Der erste Satz von Hanns Eislers Reisesonate für Violine und Klavier jedoch ist mit Con spirito überschrieben und hat, obwohl er nach Zwölftonregeln komponiert ist, etwas von den klassischen Proportionen des angenehmen instrumentalen Dialogs einer Beethoven-Violinsonate. Als glühender Sozialist wollte Eisler Musik schreiben, die für alle zugänglich ist. Diese Überzeugung verleiht seiner Musik Energie und Schwung. Das gilt auch für seine Zwölftonwerke.
Ruth Crawford Seeger, Nine Preludes, VI. Andante mystico
Die Klischeevorstellung von seriellem Komponieren sieht in etwa so aus: Die Komponistin oder der Komponist eilt durch einen Irrgarten aus Zwölferreihen und Tonblöcken, in dem sie oder er sich dem vorgegebenen musikalischen Material willenlos ausliefert. Wie die meisten Klischees beruht auch dieses auf einem Körnchen Wahrheit: Das rein akademische Jonglieren mit Zwölftonreihen hat eine ziemliche Bandbreite völlig banaler Musik hervorgebracht. Aber das Klischee täuscht darüber hinweg, wie viel Freiheit in diesem System für musikalisches Hinhören steckt. Die Werke der amerikanischen Komponistin Ruth Crawford Seeger zeigen, was passiert, wenn eine Künstlerin, die über ein hervorragendes musikalisches Gespür verfügt, einem vermeintlich kalten, rein mathematischen Konstrukt Gehör schenkt. Seegers Harmonien sind undurchsichtig und statisch, klingen nicht allzuweit entfernt von denen Debussys; ihre Motive winden sich wie zarte Pflänzchen um diese Säulen. Weil ein Flügel alleine nicht über eine Farbpalette vergleichbar mit der eines Orchesters verfügt, verschwinden viele serielle Stücke für Klavier solo schnell für immer in der Schublade. Nicht so Seegers Neun Präludien.
Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge
Obwohl der Serialismus eigentlich nicht unbedingt für elektronische Klangerzeugung steht, charakterisieren die Musikwissenschaftler:innen Pascal Decroupet und Elena Ungeheuer Stockhausens Gesang der Jünglinge als eine »Erneuerung und Erweiterung des seriellen Denkens« um Ideen aus der Akustik – im Gegensatz zum Ansatz, den Stockhausen in der späteren Stimmung verfolgte. Dieses Stück hat etwas schwer Fassbares an sich, und auch das macht für mich gute serielle Musik aus: dass sie das menschliche Gehör wirklich zum Arbeiten bringt und einen nicht in den leichten Genuss entlässt. Dass das Stück auf so eindringliche Weise ungreifbar ist, harmoniert wunderbar mit der Schönheit der offensichtlich bearbeiteten, aber dennoch sinnlichen Klänge der Knabenstimmen. Mein Lieblingsmoment dauert bei bei dieser Aufnahme etwa von 7:20 bis 7:40. Das klingt wie die venezianischen Renaissance in einem alternativen Universum, Giovanni Gabrieli in der Zeitmaschine. ¶