
Tschaikowskys sechste und letzte Sinfonie trägt den programmatischen Untertitel Pathétique. Tatsächlich hatte Tschaikowsky noch 1892, also ein Jahr vor der Entstehung der Sechsten, eine Sinfonie skizziert, die sogar eine programmatische Übertitelung jedes einzelnen Satzes vorsah: Tod, Liebe, Enttäuschung und Sterben. Seinem geliebten Neffen Wladimir »Bobik« Dawidow, der Widmungsträger der Sinfonie und schließlich Tschaikowskys Universalerbe wurde, schrieb der Komponist dagegen in einem Brief:
»[Meine neue Sinfonie ist] […] eine Programmsinfonie, deren Programm aber für alle ein Rätsel bleiben soll – mögen sie sich nur die Köpfe zerbrechen […]. Dieses Programm ist durch und durch subjektiv, und ich habe nicht selten während meiner Wanderungen, sie in Gedanken komponierend, bitterlich geweint […]. Der Form nach wird diese Sinfonie viel Neues bieten, unter anderem wird das Finale kein lärmendes Allegro, sondern – im Gegenteil – ein sehr lang gedehntes Adagio sein.«
Also war die Idee einer dezidiert programmatisch motivierten Sinfonie wieder ad acta gelegt worden. Nach der von Tschaikowsky selbst geleiteten Uraufführung am 28. Oktober 1893 in Sankt Petersburg war es aber sein Bruder Modest, der ihm angeblich vorschlug, zumindest Pathétique – wohl nicht in Erinnerung an die Grand Sonate Pathétique c-Moll op. 13 Beethovens – als Überschrift zu fixieren.
Das passte der Musikgeschichtsschreibung bald darauf hervorragend in den Kram. Denn viel und gerne wird über »letzte Werke« von Komponisten geschrieben und gesprochen. Vom Marketingstandpunkt aus betrachtet beendet ein Komponist sein wichtigstes und größtes Opus im besten Fall damit, dass ihm beim abschließenden Ziehen des Doppelstrichs hinter dem letzten Takt der Partitur die noch tropfende Feder aus der Hand fällt – und er mit einem bedeutungsschwangeren und irgendwie mysteriös durch zwielichtige Ohrenzeugen überlieferten Zitat auf den Lippen aus dem Leben scheidet.
Wir erinnern uns vielleicht an die vierzehnte Folge der sechsten Staffel von »How I Met Your Mother« (»Last Words«), in der Marshall nach dem plötzlichen Tod seines Vaters mit immer neuen Anrufbeantworternachrichten des Dahingeschiedenen konfrontiert wird – immer in der anlässlich der ersten Nachrichten berechtigt erscheinenden Angst, die tatsächlichen letzten Worte kämen aus dem Bereich Fäkalsprache oder Ähnlichem. Letztlich sind es die – lass uns den Kitsch, bitte! – Worte »I love you«, die Marshall als wirklich letzte Worte des Vaters bleiben. In der Komponistenwelt ging es diesbezüglich – nach des Dichters Goethe mal wieder unverbesserlichem »Mehr Licht!« als Steilvorlage – zumindest angenehm alltäglicher zu als befürchtet, man denke an Beethovens Jammer über den nicht mehr rechtzeitig eintreffenden (»Schade, schade, zu spät!«) beziehungsweise oral erfolgreich verabreichten Wein bei Brahms (»O, das schmeckt gut. Danke!«). Wir wissen nicht, wie die letzten Worte Tschaikowskys waren als er wenige Tage nach der Uraufführung seiner Sechsten verstarb.
Zur Todesursache des Komponisten existieren mehrere Theorien. Die These, dass sich Tschaikowsky durch die Einnahme von Arsen selbst vergiftet habe, gilt in der seriösen Forschung als nicht akzeptabel, da nur auf kruden Gerüchten basierend. Sozialhistorisch ist die These insofern unglaubwürdig, als dass die Begründung für den vermeintlichen Suizid – Tschaikowsky habe von einer Sankt Petersburger Rechtskommission aufgrund seiner Homosexualität die »Empfehlung« einer Selbsttötung nahegelegt bekommen – detailreich von Alexander Poznansky widerlegt wurde (Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man, New York 1991). Tschaikowsky hatte sich wohl gut eine Woche vor der Uraufführung der Pathétique beim Trinken nicht abgekochten Wassers mit der Cholera infiziert – und verstarb infolge dessen am 6. November 1893 im Alter von 53 Jahren in Sankt Petersburg an akutem Nierenversagen.
Das wirklich Letzte, dem Tschaikowsky sich künstlerisch widmete, war allerdings nicht seine Pathétique. Diese Orchesterpartitur war bereits Ende August 1893 fertig geworden. Anschließend arbeitete der Komponist bis kurz vor seinem Tod an der einst aufgegebenen Sinfonie Das Leben, die er dann schließlich in sein drittes Klavierkonzert einpflegte. Dieses Vorhaben hatte er parallel in Angriff genommen und es beschäftigte ihn bis zu seiner Abreise zur Premiere der Sinfonie h-Moll nach Sankt Petersburg am 21. Oktober 1893. Die Tschaikowsky-Forscherin Lucinde Braun schrieb dem Autor dieser Zeilen dazu anlässlich der Entstehung dieses Artikels:
»Das dritte Klavierkonzert konnte Tschaikowsky fast abschließen und es ließ sich später sehr gut rekonstruieren, welche Ergänzungen Sergei Tanejew hinzugefügt hatte. In meinen Augen ist das dritte Klavierkonzert einfach eine Perle – und völlig anders im Charakter als die sechste Sinfonie. Da hört man fast schon Prokofjew! Dass Tschaikowsky an beiden Werken zugleich gearbeitet hat ist typisch für ihn und zeigt, dass er sich in verschiedenen Stil- und Tonlagen gleichzeitig bewegen konnte. Seine Kompositionen sind kein simpler Abklatsch seiner Seelenzustände!«
Im letzten Jahr seines Lebens beschäftigte sich Tschaikowsky allerdings nicht ganz unfreiwillig mit dem Tod. Als hätte er sein überraschendes Ableben noch im Jahr der Vollendung der Pathétique vorausgeahnt, schrieb er seinem guten Freund, dem Großfürsten Konstantin, diese Sinfonie werde einen grandiosen »Schlussstein meines ganzen Schaffens bilden«. Hinzu kam das Wegsterben vieler nahestehender Freunde und Kollegen im Jahr 1893. Und doch ist der Tod in Tschaikowskys letzter Sinfonie auch rein musikalisch präsent. Weil der Tod bei Moll-Komponist Tschaikowsky immer präsent ist – selbst noch in seinen die Ebene des Kindes thematisierenden Werken. In der Sechsten freilich wird die Themenebene »Tod« nicht »gestreift«. Nein, hier kommt »Freund Hein« teilweise gar plötzlich mit Furor um die Ecke! Mit Drama-Kutte und Fortissimo-Sense.
Erster Satz: Adagio – Allegro non troppo
Zunächst beginnen aber die Kontrabässe ganz alleine Tschaikowskys letzte Sinfonie. Aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine sehr leise, dunkle, merkwürdig dämmrige Angelegenheit, bei der es in der unteren Bassgruppe sogleich engschrittig nach unten geht. Darüber erklingt nach wenigen Momenten der Vergegenwärtigung eben jener gruftigen Stimmung das Hauptthema des ersten Satzes, vorgetragen von dem ebenfalls nicht gerade als Symbolinstrument überbordender Heiterkeit bekanntem Fagott. Das ist die thematische Ursuppe des ersten Satzes.
Überhaupt sind alleine spielende Kontrabässe im Orchester – nicht erst seit Patrick Süskind – nie ein gutes Zeichen. Dort, wo Kontrabässe ganz oder zumindest fast solo erklingen, dort ist der Tod! Zu Beginn des dritten Quasi-Trauermarsch-Satzes von Mahlers erster Sinfonie (»Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen«) – »Bruder Jakob in Moll« – beispielsweise oder noch viel deutlicher in Giuseppe Verdis Oper Otello. Beim Eintritt Otellos durch eine »geheime Tür« in das Schlafgemach der Desdemona intoniert ein einsamer, einzelner Kontrabass – zu allem Unglück noch mit Dämpfer – ein längst zum Orchesterprobespiel gewordenes Solo. Otello erblickt Desdemona, küsst sie wach – und erwürgt sie schließlich. Der Kontrabass und der Tod. Zwei Brüder im – stark angetrunkenen – Geiste.
Bei dem legendären Orchesterdiktator Jewgeni Mrawinski und seinen Leningrader Philharmonikern (1960) klingt der bassige Sinfonie-Beginn Tschaikowskys tatsächlich wie eine »Ursuppe zum Hören«. Ist es noch die Raumakustik der Leningrader Philharmonie, das Rauschen oder sind es schon die Kontrabässe mit ihrer – hier eh nicht zu erkennenden – Quinte?
Da gehen Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker (1971) viel akademischer zu Werke. Ganz klar ist das hohle Intervall in der Tiefe zu hören. Aber dafür keine Spur eines Rätsels.
Bei Sergiu Celibidache und den Münchner Philharmonikern (1992) entsteht eine Mischung von Raunen und Klarheit. Die typische Celibidache-Entschleunigung wird jedoch hier in der Hörerfahrung zu einem Erlebnis voller Desinteresse. Das Solo-Fagott kommt nicht von der Stelle. Es langweilt. Von Beginn an. Das kann es nicht sein!
Teodor Currentzis und MusicAeterna gelingt dagegen mit ihrer Aufnahme aus dem Jahr 2017 ein erstaunlicher Beginn. Die Kontrabass-Quinte kommt ganz aus dem Hintergrund und wird einem geradezu akustisch aufgezwungen. Die nachfolgenden Instrumente breiten sich dynamisch wie eine krisenhafte Last auf dem Hörer aus; da legen sich die Bratschen mit ihrer ganzen gräulichen Flächigkeit wie eine verheerende Herbstdepression über alle Fröhlichkeit und Hoffnung. Das ist schwer erträglich und folglich wunderschön.
So schnell folgt der Tod im ersten Satz von Tschaikowskys Sechster allerdings nicht. Doch bald, nämlich schon nach etwa zwei Minuten, kommt es zu dem bis dahin wahrscheinlich schockhaftesten sinfonischen Moment der Musikgeschichte, an den wenige Jahre später Maurice Ravel in seinem 1906 begonnenen Poem La Valse mit seiner denkwürdigen Große-Trommel-Pauke-Schockstelle quasi anknüpfen sollte. Der vermeintlich wohlig-wiegende Klarinettenfriede – im ebenfalls bis dahin wohl musikhistorisch einzigartigen sechsfachen (!) Piano – wird bei Tschaikowsky brutal durch einen Fortissimo-Schlag zerstört und in einen wild erregten Teil des Satzes geführt. Hier infiziert und affiziert nun das Fagott-Thema des Beginns in x-facher Beschleunigung sämtliche Orchestergruppen. Insbesondere die Kontrabässe kommen hier spieltechnisch an ihre Grenzen, wenn es um »tonliche Schönheit« geht, die in diesem Tempo ohnehin nie gewollt und nie realisierbar war.
Bei Celibidache kam schon nach dem allzu »vorgeführten« Sinfoniebeginn der ganze Apparat nicht in Bewegung. Da, wo bei Currentzis eine neue Welt voller Blumen und erster amouröser Berührungen entsteht, da ächzen die Münchner unter der Kontrolle ihres überschätzten Maestros. Und da, wo andere Kontrabässe »irgendetwas Struppiges« spielen, da ist das Kolophonium und sein massiver Verbrauch an der »Schicksalsstelle« des ersten Satzes bei Mrawinski geradezu körperlich spürbar.
Russisches Pathos. Forcierte Emotionen. Und das farbenreiche Spiel mit dem ganzen Orchester. Tschaikowsky muss uns nicht leidtun. Musikgeschichtlich gesehen.
Zweiter Satz: Allegro con grazia
Der zweite Satz ist eine Art »stolpernder Walzer« mit viel Charme. Moskau grüßt Wien. Das »Stolpern« erzeugt Tschaikowsky durch den Einsatz eines 5/4-Taktes. 5/4-Takte lassen sich im 19. Jahrhundert – im besten Wortsinne – an einer Hand abzählen. Frédéric Chopin verwendet ihn im langsamen Satz (Larghetto) seiner ersten Klaviersonate c-Moll op. 4 (1828), Franz Liszt für seine Todesgedanken (Pensée des morts) seines Zyklus Harmonies poétiques et religieuses (1845-1852). Ungewohnt ist diese Taktart, weil der mitteleuropäische Klassikhörer unbewusst auf 2/4-, 3/4- und 4/4-Takte – mit Modifikationen (3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 6/4) – eingestellt ist. Der 5/4-Takt wird demnach durchaus als »unvollständiger«, »zu langer« oder eben »stolpernder« Takt wahrgenommen.
Tschaikowsky bedient sich der Abfolge 2 + 3 Viertel. Dabei komponiert er diesen Satz so geschickt, dass man das »Stolpern« als solches gar nicht wahrnimmt. Das Fließen dieses Satzes überspült/überspielt die vom Komponisten raffiniert eingebaute rhythmische Stolperfalle. Dieser Satz macht allein deswegen Spaß, weil man beim Hören einer Aufnahme Zuhause laut und im Konzertsaal innerlich leise »auf fünf« mitzählen kann. Ein wirklich unerwartet freudvolles Unterfangen!
Die forcierte Langsamkeit bei Celibidache funktioniert hier als ein – unfreiwilliger? – Witz. Die Celli gerieren sich als ein müder Haufen von Rosenkavalieren, die das Lied vor dem Balkon ihrer Angebeteten »nur noch so aus Scheiß« singen. Das ist interessant! Und da jauchzt dann auch das Horn nach einer Minute ganz herrlich wienerisch dazwischen (als hätte es den Rosenkavalier von Richard Strauss zu der Zeit schon gegeben).
Ähnlich träge, aber viel uninteressanter sägt die Violoncello-Gruppe unter Karajan ihren lieblos-berlinerischen Reigen – ernsthaft auf »Brillanz« ausgerichtet! Nervig, wie Karajan die Holzbläser vorschriftsmäßig einweist, alles »richtig« zu machen.
Die Genauigkeit bei Mrawinski dagegen ist frappierend, wenn auch der Charme ein wenig zu kurz kommt. Liegt es daran, dass Mrawinski hier eine Minute schneller fertig ist als die meisten anderen? Mrawinskis Geigen dagegen breiten sich am flächigsten und schönsten aus. Russisches Vibrato, russische Innerlichkeit – und jederzeit der triumphierende »Wille zum Ausbruch«!
Noch ein wenig schneller ist Teodor Currentzis mit dem zweiten Satz der Pathétique fertig – ohne, dass dies bereits zu Beginn merklich wäre. Das klingt allerdings viel zu glatt und scheint den Dirigenten nicht weiter zu interessieren. Als dann nach etwa zwei Minuten die Geigen das Zepter in die Hand nehmen, ist Currentzis ganz in seinem Element – und lässt gestalten. Das blüht ganz unaufdringlich auf und ist dabei kein bisschen glatt. Schön.
Dritter Satz: Allegro molto vivace
An schon so manchem Abend gab es nach dem extrem feurig-spritzigen dritten Satz der Sinfonie vermeintlich »Schlussapplaus«. Dabei steht das eigentliche Finale ja noch aus.
Tschaikowsky wählt angesichts dieses vorletzten Satzes eine kluge Taktik: Er spielt mit allerlei »huschenden« Gestalten, vermeidet aber im Nebeneinander der anderen Sätze einen klangspezifischen Abfall dadurch, dass er die Instrumentengruppen einzeln aufspaltet. Aus den ersten Violinen werden zwei Gruppen, aus den zweiten Violinen ebenfalls und so weiter. Damit klingt der Beginn eben nicht nach der Ouvertüre zu Mendelssohns Sommernachtstraum, sondern flächig und vollmundig; amerikanisch geradezu, wie eine Vorahnung auf Rachmaninow.
Angesichts dieses Satzes – dem vermeintlich »leichtesten« der ganzen Sinfonie – zeigt sich das wahre Gesicht aller vier hier genannten Interpreten. Fatal geradezu die Bräsigkeit Celibidaches, der seine Streicher einfach nicht von der Stelle lässt. Das klingt nach Übe-Tempo und erlaubt keinerlei Spaß und Ausbruch. Denn nichts anderes als die pure Lust hat hier Tschaikowsky Musik werden lassen. Die hohen Streicher machen den Anfang. Kleinteilige, lustig-gespenstische Tupfer, die komplett abreißen und in die Holzbläser übergehen. Ein instrumentatorischer Kniff des einfachen »Gegenübers«, den der Komponist schon so fulminant eindrücklich im Scherzo seiner vierten Sinfonie angewandt hatte: Da zupfen die Streicher einige Momente völlig alleine für sich herum, schimpfen noch ein wenig über die aufgeteilt eintretenden Oboen und Fagotte, übergeben aber schließlich den Holzbläsern zunächst den Staffelstab, um folglich die Blechbläser im Verbund mit den Pauken ihren ganz eigenen Reigen blasen zu lassen.
Hier, im dritten Satz der Sechsten, geht Tschaikowsky die Idee der radikalen instrumentatorischen Separation weniger schematisch, aber dafür umso virtuoser an. Die Wechsel der Instrumentengruppe vollziehen sich gefühlt immer schneller. Irgendwann »wischen« die Geigen nur noch in Bruchteilen von Sekunden dazwischen.
Dieses äußerst hörenswerte Nebeneinander von Gespenstern und Jokes gelingt bei MusicAeterna unter Teodor Currentzis wunderbar – nur ein wenig unter Einbuße von Leichtigkeit; aber stets risikoreich und mit der Lust an Überraschungen.
Fulminant virtuos und gerade in der Phrasierung äußerst kunstvoll gehen die Leningrader Philharmoniker dieses dann doch viel dramatischer als gedacht sich herausstellende Scherzo an. Hier wird nichts beschönigt, hier schmettern die Blechbläser herein, hier dürfen die Kontrabässe gestische Abschlüsse völlig angemessen weggrunzen. Das macht sich ausgiebig nach zweieinhalb Minuten bezahlt: Die überragenden Geigen der Leningrader holen die innere Sau raus, indem sie die pathetischen Gesten binnen Mikrosekunden abliefern, ohne, dass dadurch »die Gesamtsituation«, der Zusammenhalt strapaziert würde.
Vierter Satz: Finale. Adagio lamentoso – Andante
Tschaikowsky unterstreicht den seriösen Anspruch seiner letzten Sinfonie dadurch, dass er an das Ende einen langsamen Satz setzt. Wie Mahler nur etwa drei Jahre später in seiner dritten Sinfonie endet Tschaikowskys Sechste mit einem ausführlichen »Blick nach innen«. Dieses langsame Finale beginnt einzigartig: Die absteigende Melodie-Linie wird nicht von ein und derselben Gruppe gespielt, sondern kommt durch das trickreiche Zusammenwirken von erster und zweiter Violine zustande. Jeweils ein Melodie-Ton ertönt abwechselnd von der ersten und der zweiten Geige, der jeweils darunter liegende Ton ist nur Begleitung und »Klang-Füller«. Beim ersten Hören ist das nicht zu unterscheiden, da das allzu gehirngesteuerte Ohr – wie das Auge angesichts optischer Täuschungen – jeweils zur »einfachsten Lösung« neigt. Das Erlebnis live im Konzertsaal ist ungleich intensiver; allerdings abhängig davon, ob die ersten und zweiten Geigen gegenüber – also jeweils links und rechts vom Dirigenten – postiert sind. Es resultiert nämlich ein optisch-auditiver »Stereo-Effekt« – aber eben anhand einer als »Einheit« gehörten Melodie.
Currentzis überspielt den Beginn etwas. Die Besonderheit dieses Finals bringt er dem Hörer nicht sehr nahe. Dafür weiß dieser Dirigent noch, was ein »Pianissimo« ist – und wie es Menschen glücklich machen kann. Als nach fast drei Minuten die Pianissimo-Hörner die bald diesen ganzen Satz tragenden Triolen ins Spiel bringen und die warmen Choral-Streicher in ein flauschig bereitetes Himmelbett des Klangs legen, da wird klar, worauf es Currentzis abgesehen hat. Ihn interessiert weniger die bisherige Interpretationsgeschichte des Beginns, sondern tatsächlich der große Bogen, die Steigerungen und die Intensivierungsmöglichkeiten dieses Sinfoniesatzes. Das ist riskant. Und richtig gut.
Fast lustig zu hören, dass ausgerechnet Herbert von Karajan seinen Geigen zum Anfang das lässigste und mit Abstand deutlichste Glissando erlaubt. Sehr – zu? – ausdifferenziert dann allerdings das Nebeneinander von Holzbläsern und Streichern im weiteren Verlauf. Da behauptet jemand, Klang zu entfalten – und verbraucht viel zu viel Schweiß an den falschen Stellen. Das ist zu deutsch.
Verblüffend fast, wie unbedeutsam Celibidache den Beginn angeht, nämlich lediglich als ein Beginn wie jeder andere auch. Wenn wir Celibidaches Bruckner, seine Akribie und seine Langsamkeit gebraucht hätten, dann hier! Doch: vergebens!
Mrawinski und die Leningrader bewegen sich im Finale von Anfang an auf höchster Hitzestufe. Da wird sogar einfach mal zwei Takte vor einem vom Komponisten in der Partitur verlangten »Crescendo« forciert. Das drängt, das seufzt – und lässt dabei im Pianissimo voller authentischer Trauer los. Die schicksalsträchtigen Triolen treten fast unauffällig zur Tür herein und drängen genau an den dramaturgisch richtigen Stellen heraus. Mrawinski sortiert prächtig den Aufbau – und fordert noch nicht einmal intonatorische Perfektion ein, wie – sympathisch fast – an dem ziemlich schiefgegangenen C-Dur-Abriss nach etwa viereinhalb Minuten deutlich wird.
Bei Mrawinski erzählen die Streicher eine Geschichte voller Liebe, voller schrecklicher aber auch schöner Klagen – und voller Innigkeit. Unvergleichlich leidenschaftlich werden hier die Stahlsaiten im plötzlichen Fortissimo angegangen; eine Aufnahme dieser Sinfonie, die wohl auf immer einzigartig bleiben wird. ¶




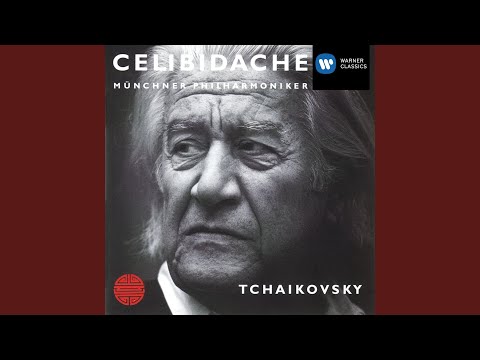







Kommentare sind geschlossen.