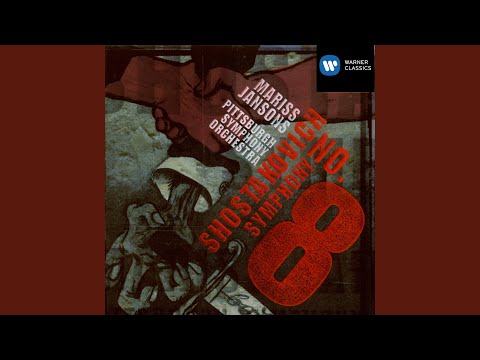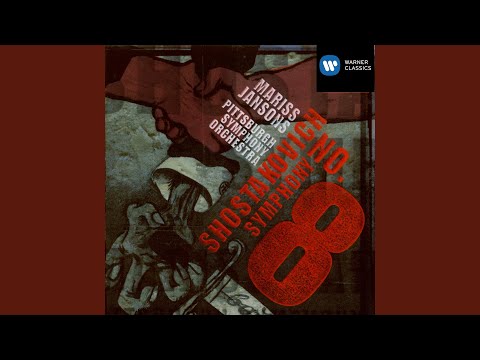In fast jeder Symphonie von Dmitri Schostakowitsch und Sergei Prokofjew kommt etwas irgendwie »Militärisches« mit hinein, abzulauschen beispielsweise am Einsatz der Militärtrommel, einem Marschrhythmus und weiterer martialischer Implikationen. (Ausnahmen wie beispielsweise Prokofjews Erste, die Symphonie classique, bestätigen die Regel.) Häufig werden dann gerade jene Sätze dieser zwei großen russischen Komponisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich wohl nicht gerade hold waren, als »politisch« beschrieben; »politisch« in dem Sinne, dass in der absichtlich verzerrten oder einfach grandios übertriebenen »Darstellung« von Kriegsgeschehnissen oder Einmärschen musikalisch das Element des »Kritischen« herauszuhören sei. (So jedenfalls das Wunschdenken vieler Musikinterpretierenden.) »Kritisch« gegenüber den Kriegstreibern, gegen den Nationalsozialismus drüben, gegen Diktatur allgemein? Auch kritisch gegen Lenin und Stalin? Eine schwierige Frage. Man streitet sich. Letztlich sitzt man im Konzertsaal und denkt sich seinen Teil. (Oder auch nicht.)
Musik und Politik. Je nun… Ein Thema, das Musikbeflissene gerne dazu nutzen, stundenlang (oder gar für die Dauer ganzer Wochenend-Symposien) aneinander vorbeizureden. Jemand hält jenes Werk für »hochpolitisch«, jemand anderes nicht; jemand Drittes interessiert sich gar nicht für den wohlmöglich politischen Hintergrund einer bestimmten Musik – und ist bis in die hintersten Schubladen seines Hirns davon überzeugt, dass Musik einfach Musik ist. Hach, wie schön! Schau dort, ein Einhorn auf lichter Flur im grünen Hain!
Musik und Patriotismus? Da wird die Fragestellung zwar unangenehm, zumindest jedoch konkreter! Angesprochen auf den »patriotischen Gehalt« von Musik sagte Schostakowitsch einmal: »Kein musikalisches Werk kann ohne Patriotismus auskommen. Beethoven zum Beispiel hätte seine großartigen Symphonien kaum schreiben können ohne Patriotismus, ohne, dass er fortschrittliche Gedanken und Auffassungen gehabt hätte – oder Schubert, Schumann, Mussorgsky, Glinka, Tschaikowsky. […] Ich denke, ein Komponist muss das tun! Ich glaube, meine Pflicht ist es, für das Volk, im Namen des Volkes zu sprechen.«
Als Musiker »im Namen des Volkes zu sprechen«: Das behauptet aktuell wohl nur ein in Hannover aufgewachsener Pianist von sich. Nun denn. Vergeben wir doch zumindest Schostakowitsch für seine Äußerung – und hören uns verschiedene Aufnahmen seiner achten Symphonie an (eine Symphonie im schicksalsträchtigen c-Moll). »Politische Musik«, etwa ausartend in fies-herrlichen Pauken-und-Trommel-Terrorakten, ist nämlich – das wird meistens vergessen oder nicht zugegeben – häufig schlichtweg: unterhaltsam. Symphonische Gewalt bei Mahler, Schostakowitsch und Prokofjew: Wir lieben das – genauso, wie uns die überzeichnete Gewalt in Filmen Tarantinos nicht abstößt, sondern uns als »Mittel« cineastisch irgendwie anmacht. Wenn es laut und blechbläserig wird, wenn es so richtig in deine Ohrwascheln hineincrasht: Da wachen wir auf, da fühlen wir uns erhaben, trappeln in Gedanken über weite Wüstenlandschaften – und erscheinen wie in Western-Filmen männlichst (lächerlich) bei Abenddämmerung am Horizont. Da! Ein Mann! Ein Pferd!
In der Rezeption sind symphonische und cineastische Gewalt also vergleichbar, selbst in Anti-Kriegsfilmen: Dem Element des Militärischen, dem Kugelhagel oder dem Marschieren im Gleichschritt wohnt immer auch eine gewisse Bejahung, ein affirmativer Effekt, eine ästhetische Überwältigungstaktik der Schaffenden bei; seien es Komponist:innen (angeblicher) »Kriegssymphonien« oder Regisseur:innen filmischer Schlachtengemälde. (Wer würde die lange Anfangssequenz von Steven Spielbergs Saving Private Ryan nicht als zumindest »gut gemacht« bezeichnen?)
1. Satz: Adagio – Allegro non troppo
Tatsächlich nennt man Schostakowitschs 1943 komponierte und am 4. November des Jahres in Moskau mit Jewgeni Mrawinski am Pult des Staatlichen Sinfonieorchesters der UdSSR uraufgeführte achte Symphonie c-Moll op. 65 – zusammen mit der Siebten und Neunten – bisweilen »Kriegssymphonie«. Von dem bejahenden Element kriegerischer Musik – »Männlichkeit«, Triumph, Donnergebrüll – ist zu Beginn des tief in den Bässen anhebenden ersten Satzes noch nichts zu spüren. Signalartig begeben sich bald die höheren Streicher dazu. Getragene Stimmung, gerade so wie in den Vorwehen der dynamischen Höhepunkte von Wagners Trauermarsch auf den Tod Siegfrieds in der Götterdämmerung.
Der erste Einsatz der Blechbläser lässt im Eingangssatz lange auf sich warten. Die Streicher verkünden vier Minuten nichts Gutes – da setzen schließlich die schmerzvollen Bläser ein und bringen das ganze Gefüge in eine noch dissonantere Schieflage.
Mit gründlicher Attacke ketten sich Celli und Bässe der Leningrader Philharmoniker unter Jewgeni Mrawinski (Live, 1961), dem die Symphonie gewidmet ist, an die von schärfsten Punktierungen gekennzeichneten Stahlstelen der zerrissenen Trauer im Fortissimo. Das gibt hier bei den Leningradern schon beim Berühren der Saite ein Geräusch. (Stets kein Zeichen von Unkonzentriertheit, sondern im Gegenteil: Beteiligung, Leidenschaft, Vergessen des Musiker:innen-Beamtentums!). Die kleinen Crescendi werden gerade in den Kontrabässen zu eindrücklichen Drohgebärden. Ganz fahl kriechen die spät einsetzenden ersten Geigen im Pianissimo darüber hinweg. Hervorragend, wie absichtlich »unangenehm« und kein bisschen schöngeistig, falsch befriedend Mrawinski das vortragen lässt. Dissonant türmen sich die Stimmgewerke auf. Es trötet absichtlich falsch aus dem Orchester hinaus.
Beim »Poco più mosso« gerät die Symphonie in einen 5/4-Takt hinein. Fast alle Streicher spielen jetzt gestoßene Abstrich-Töne – aber noch leise. Erste Anzeichen des Martialischen. Die Flöte hatte die Überleitung geschaffen und verbleibt noch einen Moment über dem Quasi-Streichquintett. Zwei Takte später beginnen die ersten Violinen und exponieren ein – Bruckner lässt grüßen – Quintfall-Quintaufstiegs-Motiv mit anschließender kleiner – ebenfalls changierender – Sekunde; die kleine Sekund-Abweichung in der Melodie-Bildung: hier und auch sonst bleibt die kleine Sekunde Schostakowitschs Lieblingsintervall! Bei Mrawinski nuscheln die Streicher fast, raunen etwas ohne jegliche Motivation der »Genauigkeit« in den Saal. Kein Unvermögen, sondern Interpretation!
Etwas gediegener und akademischer spielen die Streicher des Berliner Sinfonie-Orchesters (1977) unter Schostakowitsch-Freund Kurt Sanderling den Beginn. Erstaunlich einheitlich und kompakt. Gedrungen und gezogen die Linien in den Bässen. Man hört, dass Sanderling unter Mrawinski zweiter Chefdirigent der Leningrader Philharmoniker war. Die große Schostakowitsch-Erfahrung nahm er einst mit nach Ost-Berlin. Voller, sonorer und schöngeistiger lässt er allerdings die überführenden Violinen den Reigen der elend zerbissenen Traurigkeit anstimmen. (In der profunden, warmtönenden Streicherkultur ähnelten sich schon damals die beiden Ost-Berliner Orchester: die Staatskapelle und das besagte Berliner Sinfonie-Orchester.) Der Unterschied liegt darin, dass Sanderling zu wenig Hässlichkeit einfordert. Die wäre vielleicht vonnöten, schließlich komponiert Schostakowitsch doch recht eindeutig eine eigentlich – und mit grob verletzender Intention! – viel zu lange »Einleitung«. Schostakowitsch will das Publikum leiden sehen. Und das realisiert Mrawinski mit seiner hässlichen Gebärde doch überzeugender.
Wunderbar wuppig geraten jedoch die Pizzicato-Blöcke ins Ohr. Es ist dieses kollektive, wirkliche Zusammenspiel, das auch »Ost«-Klangkörper wie das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin bis heute auszeichnet. Man will, man kann, man klingt. Keine Berliner-Philharmoniker-Vereinzelung, sondern das verständigende Miteinander.
Witzigerweise klingt die Flöten-Überleitung bei Sanderling tatsächlich nach »Hoffnung«. Ist das wirklich ein »Leuchten«? Aber schön ist es! Schön! Viel einheitlicher jedenfalls präsentiert sich der stotternde Streicherteppich bei Sanderling und seinen Kolleg*innen. Da gibt es auch kleine Binnen-Dynamiken, die das ganze Konstrukt lebendiger wirken lassen. (Aber sollte es nicht tatsächlich »toter« sein?).
In der Live-Aufnahme aus dem Jahr 2001 gewichtet Mariss Jansons am Dirigentenpult des Pittsburgh Symphony Orchestra die Streicher von Beginn an in unnachahmlicher Weise. Jeder bekommt seinen Platz freundlich aber bestimmt zugewiesen. Dort, wo die eine Stimme das »Sagen« hat, weicht die andere ein wenig zurück. Die große Stärke Jansons, Klänge und Verläufe profund und dramaturgisch spannungsreich zu disponieren, geht sich hier voll aus. Selbst ein sonst als stets – typisch amerikanisch – »brillant« geltendes US-Orchester vermag im Folgenden den hohen Streicherklängen etwas Angerautes zu verleihen, was angesichts der Turm- und Tonübungen des klagenden Schostakowitschs – wie bereits erwähnt – dringend nötig ist. Dafür stechen dann »schöne« Geigentöne in der Spitze wiederum fein kontrastreich heraus. Ein Mix von hässlich und schön. So wird Schostakowitsch nicht langweilig!
Die äußerst konzentriert vorgetragene Flöten-Überleitung gelingt großartig, zumal Jansons die raunende Streicher-Begleitung gleich »menschelnd« ergründe(l)t. Bei Jansons lebt alles immer so wunderschön! Die Instrumente erzählen uns tatsächlich etwas! Das kann man anfassen!
Noch dunkler intonieren die Streicher des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Bernard Haitink (Live-Aufnahme vom 23. September 2006 in der Münchner Philharmonie im Gasteig) den Symphonie-Anfang. Doch die kleinen Crescendi wirken hier ganz und gar nicht drohend, sondern eher warm brütend. Eher Landschaftsbeschreibung als existenzielle Gefahr. Nicht falsch, aber irritierend schön. Wie Haitink allerdings dann die Violinen anleitet, ihre ersten Takte völlig »tot« zu musizieren, das zeigt die Stärke dieses ja irgendwie nie ganz »besonderen« Dirigenten, der auf Schostakowitsch – gerade in den späteren Symphonien – schon immer einen guten Zugriff hatte.
Etwas nichtssagend geht es dann weiter. Man fragt sich, ob diese Musik auf diese Weise in der Rezeption der Hörenden wirklich »tragen« kann, wenn dann doch schließlich nur so musiziert wird, als handele es sich hier eben um eine »normale« Symphonie. Nein, denn, wie gesagt: Schostakowitsch komponiert hier Qual! Und nicht etwa Liebesleid oder ähnlichen Quatsch. Fast ein wenig gehetzt wirken die Streicher dann im »Poco più mosso«. Aber dieses daraus im Höreindruck entstehende »Wohin?« überzeugt hier.
2. Satz: Allegretto
Drohend, dräuend hebt sogleich der zweite Satz (Allegretto) ein. In stampfenden Rhythmen drängt es bald vorwärts. Die große Trommel haut zu. Die grellen Holzbläser verspotten den Gegner. Doch bald säuselt alles in beschützte, leise Gefilde zurück; geschunden, getreten – doch dann überraschend auf der Piccoloflöte ein »lustiges Lied« pfeifend.
»Bämm« geht es also los. Der Streicherapparat in Eintracht mit Fagott, Bassklarinette und Pauken wämmst sein Fortissimo auf die »Eins« des Satzes. Unmittelbar eine Viertel danach stemmt sich der akkordisch-symphonische Schwellkörper der anderen Instrumentengruppen dagegen. Eine engschrittige Linie arbeitet sich in drängenden Panzerschüben – eine »Melodie« bildend – nach vorne.
Mrawinski macht hier keine Kompromisse. Das wird einfach so weggehauen; als gäbe es kein gestern! Hat ausgerechnet jener Interpret diese Musik am »politischsten« verstanden? Und das direkt vor der eigenen Haustür? Herrlich, wie schmerzend die Piccoloflöte uns bald quält! Das kann niemals nicht »nett« gemeint gewesen sein! Спасибо!
Um Einiges verhaltener gehen das Berliner Sinfonie-Orchester und Kurt Sanderling den zweiten Satz an. Da wird nach dem anfänglichen Motto fast so etwas wie eine Schein-Zensur eingelegt, um den »wirklichen« Marsch ganz preußisch loszuexerzieren. Gar nicht falsch – und vor allem sehr gut anhörbar! Das sitzt! (Zumal die hervorragende DDR-Aufnahmetechnik zur Durchhörbarkeit der Holzbläser-Engleis(s)ungen wertvoll beiträgt.)
Mariss Jansons lässt sein Orchester die Klänge am krassesten »hochziehen«. Wie herrlich unangenehm ist das denn bitte? Die Akkorde rasen auf dich zu. Und anschließend schafft Jansons den besten Kontrast, da er die folgenden Marsch-Karikaturen Schostakowitschs besonders kurz und schnippisch vorführen lässt. Ein Meister der kulminierenden, kompakt mit kleinen Händen modellierten Kontraste!
Viel breiter und fleischhaltiger lässt Haitink mit dem BR-Orchester den Satz hinfort ziehen. Das quetscht akkordisch immerzu gewaltig und nussig voran. Toll, wie gemein und hinterfotzig Haitink die falschen Freundlichkeiten anschließend musizieren lässt. Ein Orchester: ebenfalls wie geschaffen für Schostakowitsch!
3. Satz: Allegro non troppo
In steten, forschen Vierteln der aufgescheuchten Viola-Gruppe beginnt der dritte Satz (Allegretto non troppo). In dem Moment, in dem man sich fragt, wann sich die Tonkette wohl verändern wird, fährt es den Bratschen aus den Bässen heraus auch schon mächtig in die Parade. Ächzend hohe Holzbläser kämpfen sich ihrerseits dazwischen. Ein pseudofröhliches Spiel des Schreckens!
Krächzend loseiernd gehen die Leningrader Philharmoniker das Allegretto an. Wieder kein Frieden, kein Spiel, keine wirkliche Symphonie. Sondern nur gulpige Emotionszustände am Rande jeglicher Klangästhetik. Eigentlich Wahnsinn. Dumpf hauen die tiefen Streicher in die Magengrube. Die Schreie von Oboe, hohen und mittleren Klarinetten scheuern dir motivische Tinnitus-Gemeinheiten in die Fresse. Wie radikal! Schostakowitsch: hysterisch informiert.
Kurt Sanderling geht die ganze Chose gefühlt halb so schnell an. Durch die plastische Aufnahmetechnik hören wir das Kolophonium der Streicher umso mehr reiben. Das klingt zunächst viel braver, doch Sanderling weiß, was er tut! Durch die Genauigkeit des Spiels entsteht keinerlei »Verlust« in der ästhetischen Hör-Rezeption. Schostakowitsch kann viel mehr ab als erwartet. Interpretationsunterschiede können so Spaß machen.
Fast harmlos kommt uns der dritte Satz bei Mariss Jansons und dem Pittsburgh Symphony Orchestra entgegen. Alles etwas ausgedünnt, fast schlank! Vielleicht die schwächste – weil hier an falscher Stelle unradikalste – Einzelsatz-Interpretation dieses Aufnahmenvergleichs? Doch später ziehen dröhnende Crescendi herein in die vermeintlich so harmlose Galopp-Landschaft. Jansons spart! Und bohrt umso intensiver ins Lauschefleisch der Viertel-Verblödung!
Bernard Haitink lässt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks das Allegretto ungefähr im Tempo Sanderlings losmusizieren. Noch einmal sonorer und wuppiger. Schön dunkel krachen die Einzelschicksalsschläge herein. Doch irgendwie steht das ganze Symphonie-Satz-Gerüst hier zu sehr auf der Stelle. Wobei daraus ein gewisser Hör-Schmerz, eine nicht erfüllte »Erwartungshaltung« resultiert, die wiederum völlig angebracht erscheint.
4. Satz: Largo
Nicht etwa die wohlige Entspannung eines langsamen Satzes bringt das Largo, das »attacca« (also ohne richtigen »Schluss« des Satzes zuvor) angegangen wird. Dabei geraten wir erst einmal in die Mangel einer gigantischen Orchestermaschine. Der schnelle Abbruch dieses Donnerwetters bringt wieder klagende Zerknirschung in den leisesten Streichertönen. So viel zur Theorie. Man haut auf das Tamtam, ein gellender Schrei des ganzen Orchesters brüllt also los. Hohe Streicher auf tiefen Saiten bleiben übrig – und müssen sich nun um die Opfer kümmern.
Fast bis zum Verstummen lässt Mrawinski die Streicher herniedersinken, während Sanderling zunächst eine fast amerikanisch brillante Klangästhetik vorführt und die wütende Verzweiflungsgeste ähnlich wie Mrawinski ins Nichts der Hoffnung abbiegt. Das Berliner Sinfonie-Orchester erlaubt sich ein fragiles Pianissimo, das selbst noch im Nichts angenehm »warm« erbebt. Fast harmlos und opernouvertürenhaft erklingt der Schockmoment des Largo-Anfangs bei Jansons, der den leisen Kreuzgang der folgenden Takte noch einmal weiter – bis ins wirklich Unhörbare – zurückschraubt. Haitink lässt seine Musiker:innen dagegen viel mehr erbeben, erzittern; schon die Anfangsklänge erschüttern in ihrer Menschlichkeitsanmutung. Da ist Leben drin. Es gibt lebendiges Leben im Toten. Berührend.
5. Satz: Allegretto
Fast freundlich dagegen der Beginn des Final-Satzes (Allegretto). Ein ruhiger Halteklang, ein leicht angeknatschter Dialog von Englisch Horn und Fagott. Wohin soll das Ganze führen? Ist hier Hoffnung im Spiel? Verwegen – doch zur Melodie bemüht – greifen die Violinen ein. Aber die engschrittigen tiefen Streicher verheißen erneut nichts Gutes. Wir vernehmen punktuelle Flötentöne, ja sogar eine Triangel mischt mit. Kurze Momente der Hoffnung. Oder doch nicht? (Ja, was denn jetzt, zum Teufel?)
Etwas spät lässt Mrawinski den Fagottisten sein Solo austrudeln. Erst dort, wo Schostakowitsch sich schon wieder ein »a tempo« wünscht, kullert das Fagott sein hier an falscher Stelle platziertes Ritardando (der Komponist denkt sich die Einleitung der Verzögerung bereits vier Takte früher!) zum Ende hin aus. Viel zu romantisch an dieser Stelle. Hier will ich – das Fagott hat haarsträubend hohe Nasalitäten zu vollbringen – Leiden hören; kein romantisches »Ach-Gottchen-Ritardando«!
Ganz bewegt und emotional sanft beteiligt hebt das Fagott in Sanderlings Orchester seinen eigentümlichen Gesang an, findet auf dem Weg verschiedene Farb-Schattierungen – und nur ein hauchzart angedeutetes Ritardando, dem Sanderling wohlmöglich eh skeptisch gegenüberstand, hier ist zu hören. Ganz differenziert und beredet bringen die Streicher ein kurzes Zwischenspiel. Nun übernimmt die Flöte und packt gemeinsam mit der Triangel aus. Ein sozialistisches Kinderspiel. Nicht wirklich lieb gemeint – und hier fast zu schön musiziert.
Der Interpretation Jansons’ mangelte es leider an tontechnischem Gespür. So ömmelt das Solo-Fagott viel zu sehr aus dem Hintergrund herüber. Etwas flink nehmen die Streicher den Übergang, glatter noch als aus den Reihen der Berliner. Verhalten und wieder fein »aufgespart«: das anschließende Flöten-Solo.
Schön, wie Haitink es den anderen begleitenden Fagotten erlaubt, ihrem Solo-Kollegen knöterichartig zur Seite zu stehen. Ein echt kammermusikalisches Spiel, wie man es sich wünscht. Doch zu eintönig und mit zu viel Einverständnis »angesichts der Gesamtsituation« mümmeln sich die Streicher daraufhin in Schönklang ein. Die anschließenden Spielereien klingen wie Mahler 4. Nicht falsch. Aber eben nicht Schostakowitsch 8. ¶